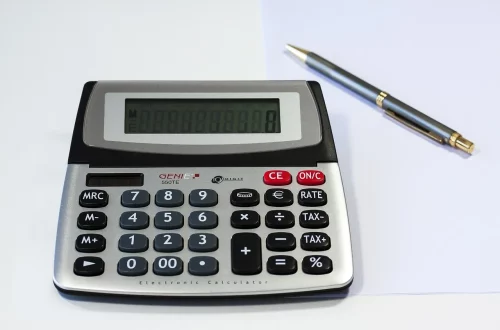Sparmaßnahmen belasten besonders Geringverdiener
Laut einer aktuellen Analyse des Budgetdienstes zeigt sich eine signifikante Ungleichheit bei der Verteilung der finanziellen Belastungen, die durch die Nettokonsolidierung entstehen. Die einkommensschwächsten zehn Prozent der Bevölkerung tragen demnach acht Prozent des Nettokonsolidierungsvolumens, während das einkommensstärkste Zehntel 14 Prozent beisteuert. Dies bedeutet, dass finanzielle Maßnahmen wie die ausgesetzte Abgeltung der kalten Progression und die Erhöhung der Krankenversicherung für Pensionisten und Pensionistinnen stärker auf besser gestellte Haushalte wirken. Im Gegensatz dazu trifft die ausgesetzte Inflationsanpassung von Sozialleistungen, wie der Familienbeihilfe, insbesondere die einkommensschwächsten 20 Prozent der Bevölkerung überproportional.
Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass bei der Erhöhung des Pendler-Euros und der steuerfreien Mitarbeiterprämie größere Anteile auf die obere Einkommenshälfte entfallen. Die absolute Belastung durch die Nettokonsolidierung hat jedoch eine relativ stärkere Auswirkung auf Haushalte mit geringeren Einkommen. Ein Beispiel hierfür ist die Abschaffung des Klimabonus, die bei Haushalten mit niedrigen Einkommen zu einer höheren relativen Einkommensreduktion führt.
Wirtschaftliche Auswirkungen und Einkommensreduktion
Emanuel List, Ungleichheitsforscher von der Wirtschaftsuniversität Wien, betont, dass die unteren Einkommensschichten relativ mehr zu den Konsolidierungsmaßnahmen beitragen. Dies hat auch negative Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum, da Haushalte mit niedrigem Einkommen in der Regel weniger sparen und mehr konsumieren. Fehlt dieser Konsum, hat dies direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Dynamik.
Im Jahr 2025 wird erwartet, dass die Maßnahmen der Bundesregierung das durchschnittliche Haushaltseinkommen um 0,8 Prozent reduzieren. Während die Einkommensreduktion bei den einkommensstärksten zehn Prozent 0,4 Prozent beträgt, müssen die einkommensschwächsten zehn Prozent mit einem Rückgang von 2,3 Prozent rechnen. Diese Ungleichheit wird bis 2029 weiter zunehmen, wo die Reduktion des durchschnittlichen Einkommens auf 1,6 Prozent ansteigt. Die Unterschiede im Verhältnis zum Einkommen liegen dann zwischen 1,1 Prozent für die oberen Einkommensschichten und 3,3 Prozent für die unteren.
Politische Reaktionen und Maßnahmen der Bundesregierung
Die Grünen sehen sich durch die Analyse in ihrer Kritik an der Bundesregierung bestätigt. Alma Zadic, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, äußerte, dass die Regierung an den falschen Stellen spare und insbesondere Familien, Kinder und Alleinerziehende belaste. In ihrer Aussage betonte sie die Notwendigkeit, die finanziellen Sorgen von einkommensschwachen Haushalten zu berücksichtigen, und kritisierte, dass Spitzenverdiener nicht betroffen seien.
Finanzminister Marterbauer reagierte auf die Kritik und wies darauf hin, dass die Streichung des Klimabonus und die Nichterhöhung der Kinderbeihilfe negative Verteilungseffekte hätten. Er betonte jedoch, dass man Maßnahmen mit positiven Verteilungseffekten setze, die nicht direkt Personen zugeordnet werden könnten, aber vor allem einkommensschwachen Gruppen zugutekämen. Dazu zählen Verbesserungen bei sozialen Dienstleistungen, wie dem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr und dem Ausbau der psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen.
Marterbauer kündigte zudem die Gründung einer „Task Force Förderungen“ an, die sich mit Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung beschäftigen soll. Er hofft, dass diese Initiativen positive Verteilungswirkungen mit sich bringen werden und kündigte an, dass weitere Maßnahmen zur Unterstützung besonders armutsgefähr
Quelle: https://orf.at/stories/3394535/